Der Hauptveranstaltungsort der AlpenWoche ist das Perla Konferenzzentrum. Einige Veranstaltungen werden an anderen Orten stattfinden, die in der jeweiligen Beschreibung angegeben sind.
Montag, 23. September
14:00 – 17:00
Begrüßungs-Exkursion – Ohne Grenzen
Gorizia – Nova Gorica
Organisiert von: Posoški razvojni center – Entwicklungszentrum des Soča-Tals
Ort: Start: Bahnhof Gorizia Centrale (IT) / Ende: Xcenter, Nova Gorica
Kurzbeschreibung: Die Begrüßungsexkursion bringt die Teilnehmenden symbolisch zwischen zwei Länder und zwei Städte, die direkt an der Grenze nebeneinander liegen. So nah und doch so verschieden… Gorizia auf der italienischen Seite und Nova Gorica auf der slowenischen. Auf einer geführten Radtour mit mehreren Stopps an zentralen Stationen in beiden Städten können alle Teilnehmenden die Merkmale, Unterschiede und Ähnlichkeiten auf beiden Seiten der Grenze des gemeinsamen Gebiets und die als Kulturhauptstadt Europas GO! 2025 gefeierten Zwillingsstädte kennenlernen.
Praktische Informationen
Sprache: Englisch
Teilnehmendenzahl: max. 30
Ausrüstung: Regenbekleidung
Für Teilnehmer, die keine eigenen Fahrräder besitzen, werden vor Ort Fahrräder zur Verfügung stehen.
Thema: Lebensqualität
14:00 – 17:00
Side event
TQoL Living Labs – Austausch von Erfahrungen und deren Einbeziehung in die alpine Praxis
Organisiert von: ESPON Kontaktpunkt Slowenien
Ort: Perla Hotel, Pinta Saal
Kurzbeschreibung:
Bei der Veranstaltung werden praktische Erfahrungen mit dem Instrument der TQoL Living Labs im Alpenraum vorgestellt. Die Living Labs wurden im Rahmen der Projekte ESPON Territorial und Alpine Compass: Jugend für Lebensqualität in den Alpen (CIPRA Slovenija) organisiert. Bei der Veranstaltung werden wir mit eingeladenen Expertinnen und Experten die gewonnenen Erfahrungen und die Möglichkeiten zur Integration der Living Labs-Methode in laufende Planungsaktivitäten und -prozesse teilen.
Praktische Informationen
Sprache: Englisch
Teilnehmendenzahl: max. 40
Die Kosten für die ESPON-Nebenveranstaltung werden vollständig von den Organisierenden übernommen. Daher ist die Veranstaltung kostenlos.

18:00 – 19:00
Filmvorführung: ACTIVIST
Organisiert von: CIPRA International – Projekt Yoalin, Kulturni Dom, CIPRA Slowenien
Ort: Kulturni Dom, Nova Gorica
Wie gehen wir mit der ökosozialen Krise um? Ist Aktivismus eine Utopie? Der Dokumentarfilm ACTIVIST begleitet sieben junge Menschen vom Team Seeding for Future. Sie trafen in Slowenien, Italien, Polen, Deutschland und Belgien Aktivist:innen und Initiativen, die sich für Klima und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Die inspirierenden Gespräche zeigen die Vielfalt der Ideen und Strategien zur Gestaltung einer gerechteren und umweltfreundlicheren Welt. Im Anschluss an die Vorführung gibt es ein exklusives Gespräch mit dem Produzenten Arthur Parmentier. Lassen Sie sich von den Geschichten von zivilem Ungehorsam bis hin zum Europäischen Parlament mitreißen und entdecken Sie neue Wege des Engagements über Grenzen hinweg.
Praktische Informationen
Originalsprachen mit englischen Untertiteln
Eintritt frei! Keine Anmeldung notwendig.
Das Kulturni Dom ist zwei Gehminuten vom Xcenter entfernt. Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Projekts YOALIN von CIPRA International durchgeführt und finanziell unterstützt vom Amt für Umwelt Liechtenstein.
Weitere Informationen:
18:00 – 19:00
Runder Tisch: Wo sich die Alpen zur Adria neigen
Organisiert von: GO! 2025 und AlpenWoche
Ort: Xcenter Nova Gorica, Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica
Kurzbeschreibung:
Eine Diskussion über die Kunst der Erinnerung und die Fronten der Gegenwart
Im Gespräch mit drei Akteuren des offiziellen Programms der „Kulturhauptstadt Europas 2025 Nova Gorica – Gorizia“ werden wir entlang der Frontlinien des Ersten Weltkriegs, der Beseitigung der Eisenbahnschienen in der Kolodvorska-Straße und der Grenzüberschreitung der Partnerstädte des Ballungsraums geführt.
Teilnehmende:
– Professor Dr. Saša Dobrič, Universität Nova Gorica, Direktor des Doktorandenprogramms in Kulturerbe-Studien
– Professor Maša Klavora, Aktivistin und Koordinatorin, die an das Soča-Tal und die europäische Idee des Friedensweges glaubt
– Andrea Bellavite, Schriftsteller und Theologe, Autor des Kulturhauptstadtführers „Gorizia Nova Gorica. Verbundene Städte“
Die Diskussion wird moderiert von Dr. Stojan Pelko, Programmleiter von GO! 2025.
Weitere Informationen:
19:00
Alpiner Apéro
Organisiert von: GO! 2025 und AlpenWoche
Ort: Xcenter Nova Gorica, Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica
Alle Teilnehmenden sind dazu eingeladen, lokale Speisen und Getränke mitzubringen, um die Vielfalt der alpinen Esskultur zu feiern.
Bitte kennzeichnen Sie die Zutaten der mitgebrachten Lebensmittel.
Dienstag, 24. September
08:30 – 09:00
Anmeldung – Kaffee
09:00 – 10:30
Begrüßung und Einführung
Die AlpenWoche wird moderiert von Sofia Farina und Miro Kristan
Begrüßung
Alenka Smerkolj (Generalsekretärin der Alpenkonvention)
Emil Ferjančič (Ministerium für Natürliche Ressourcen und Raumplanung, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses der Alpenkonferenz)
Keynote 1: Biophysikalische, wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Grenzen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
Referentin: Lučka Kajfež Bogataj, Klimatologin, Professorin an der Fakultät für Biotechnologie in Ljubljana und Mitglied des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen – IPCC. Sie gilt als eine Pionierin in der Forschung zum Klimawandel in Slowenien, mit besonderem Forschungsschwerpunkt auf den Auswirkungen von Wetter und Klimawandel auf die landwirtschaftliche Produktion.
Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und intensivere und häufigere Naturgefahrenereignisse werden sich auf die Landschaften und Prozesse in der alpinen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft auswirken. Um eine nachhaltige Entwicklung des Alpenraums vor dem Hintergrund des Klimawandels zu ermöglichen, sind sowohl Abmilderungs- als auch Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Naturschutzmanagement, Tourismusindustrie und lokale Gemeinschaften haben eine Reihe von Minderungs- und Anpassungsstrategien implementiert oder empfehlen solche. Die Strategien einiger Interessengruppen ergänzen sich gegenseitig, andere hingegen stellen potenzielle Konfliktquellen dar. Leider können Minderungs- und Anpassungsstrategien an biophysikalische, wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Grenzen stoßen.
Keynote 2: Tatsächlich in unseren Händen – Optimistische Überlegungen zur Biodiversitäts-Governance
Referentin: Serena Arduino, Präsidentin von CIPRA International, Beobachterin im Alpinen Biodiversitätsbeirat und in den EUSALP-Aktionsgruppen für grüne Infrastruktur und natürliche und kulturelle Ressourcen.
Ein Blick auf die Governance der biologischen Vielfalt auf globaler, europäischer und alpiner Ebene. Ein Rückblick auf die vergangenen zwanzig Jahre und ein Ausblick auf die kommenden zwanzig Jahre, ausgehend von Fakten und den Meinungen der wichtigsten Beteiligten im Bereich Biodiversität aus Zivilgesellschaft und wissenschaftlichen Institutionen. Die Sichtweise einer unverbesserlichen Optimistin.
Keynote 3: Gemeinwohl-Ökonomie – ein Wirtschaftsmodell für gute Lebensqualität
Referent: Christian Felber, Autor, Hochschuldozent, Initiator der „Gemeinwohl-Ökonomie“ und der „Genossenschaft für Gemeinwohl“, Österreich
Das aktuelle Wirtschaftssystem ist auf Profit, Rendite und unbegrenztes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ausgerichtet. Zu diesem weder nachhaltigen noch menschlichen Modell entstehen derzeit zukunftsweisende Alternativen, eine davon ist die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ). Bei der Messung von Lebensqualität muss das Wohl aller Menschen und der Natur eingerechnet werden: Dafür bietet die Gemeinwohl-Ökonomie das Gemeinwohl-Produkt (Volkswirtschaft) und die Gemeinwohl-Bilanz (Betriebswirtschaft). Wie können diese Instrumente in Zukunft genutzt und in politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden?
Weitere Informationen:
10:30 – 11:00
Kaffeepause
11:00 – 12:00
Teilnehmende: Matej Ogrin (Präsident von CIPRA Slowenien), Christina Bauer (Leiterin der Verwaltungsbehörde, Interreg-Alpenraumprogramm), Ingrid Fischer (Vorsitzende Verein Alpenstadt des Jahres), Nina Seljak (Nationale Koordinatorin der makroregionalen EU-Strategien), Miha Kobal (lokaler Landwirt aus dem Soča-Tal), Jacqueline Hillmann (für das AlpDorf Balderschwang tätige junge Mitarbeiterin). Rückblick der vergangenen 20 Jahre und Moderation durch Claire Simon (Val&Monti).
Kurzbeschreibung: Vertreterinnen und Vertreter von transnationalen Organisationen bis zur lokalen Landwirtschaft befassen sich in dieser Podiumsdiskussion eingehend mit der sich verändernden Landschaft des Lebens, der Arbeit und des Handelns in den Alpen. Begleiten Sie uns, wenn zwei Jahrzehnte der Veränderungen reflektiert werden: Wie hat sich das Leben in den Alpen verändert? Welche positiven Entwicklungen und Initiativen haben die Teilnehmenden in ihrem Handlungsfeld erlebt und wo sehen sie Verbesserungsbedarf? Das Gespräch verspricht Einblicke, Anregungen und einen Aufruf zum Handeln, um den Weg für eine lebenswerte Zukunft für die Menschen und alle anderen Lebewesen in den Alpen zu ebnen.
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
13:30 – 18:00
Exkursion 1
Klimawandel und Klima-Herausforderungen im Vipava-Tal
Exkursionsleitung: Adrijana Perkon (Primorska Universität, Fachbereich Geographie)
Kurzbeschreibung:
Der Schwerpunkt der Exkursion ins Vipava-Tal liegt auf den Auswirkungen des Klimawandels, die sich in der Landwirtschaft, einem der wichtigsten Wirtschaftszweige des Tals (Wein- und Obstanbau), deutlich bemerkbar machen. Besuchen Sie mit uns den u.a. der Bewässerung dienenden Stausee Vogršček, die Karstquellen des Flusses Vipava und einen Bauernhof. Es erwartet Sie ein Einblick in die Erfahrungen der Menschen vor Ort im Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels und Verkostung von köstlichen lokalen Erzeugnissen.
Praktische Informationen
Sprache: Englisch
Teilnehmendenzahl: max. 30
Ausrüstung: Wanderschuhe, Regenbekleidung
Kosten: 10 Euro
Themen: Klima, Biodiversität
Exkursion 2
Die Geschichte des Waldbrandes auf dem Karst
Exkursionsleitung: CIPRA Slowenien, Slowenischer Forstdienst, freiwillige Feuerwehr aus Komen, Tourismusinformationszentrum Miren Kras
Kurzbeschreibung: Das Karstgebiet wurde 2022 vom größten Waldbrand in der Geschichte Sloweniens heimgesucht. Die Exkursion beginnt in der Nähe der italienischen Grenze in Opatje Selo, von dort geht die Wanderung in Richtung Cerje. An mehreren Stationen stellt der slowenische Forstdienst das Ausmaß des Waldbrandes, seine Auswirkungen auf die Artenvielfalt, den Forst-Sanierungsplan und seine Implementierung und die Wiederaufforstung des Karsts in den letzten 150 Jahren vor. Während der Brände und auch noch danach spielten freiwillige Helferinnen und Helfer eine wichtige Rolle. Ein örtlicher Feuerwehrmann stellt die Arbeit der lokalen Feuerwehren vor und berichtet von seinen Erfahrungen vor Ort. In Cerje besuchen wir anschließend das Friedensdenkmal und den Aussichtsturm. Dieser großartige Bau steht inmitten eines natürlichen Amphitheaters und bietet einen herrlichen Blick in alle vier Himmelsrichtungen: die Adria, die friulanische Tiefebene, die Julischen Alpen und das Vipava-Tal. Die Exkursion endet mit einer Verkostung lokaler veganer Produkte auf dem Bio-Bauernhof Tavčar in Nova Gorica.
Praktische Informationen
Sprache: Englisch
Teilnehmendenzahl: max. 30
Ausrüstung: Wanderschuhe, Regenbekleidung
Kosten: 10 Euro
Themen: Klima, Biodiversität
14:00 – 15:30
Session-Leitung und eingeladene Fachleute: Katharina Zwettler, Vorsitzende des Alpinen Klimabeirates (ACB), Bundesministerium für Klimaschutz (Österreich), Orsolya Lelkes (Psychodrama Director)
Kurzbeschreibung:
Wo sehen wir, der Alpine Klimabeirat (ACB), Hindernisse bei der Umsetzung von Aktivitäten in unserer Arbeit für klimaneutrale und klimaresiliente Alpen 2050? Der ACB bietet Formate zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten und Methoden zur Unterstützung der auf alpiner Ebene tätigen Multiplikatoren, um maßgeschneiderte Ansätze für den Klimaschutz zu entwickeln. Schwerpunkte sind der Faktor Mensch und positive Erzählungen, die mit lokalen Kontexten und spezifischen Bedürfnissen verbunden sind. Wir möchten den Workshop damit beginnen, unsere ersten Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen und dann Einblicke in IHRE Erfahrungen und Prozesse im Zusammenhang mit Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung zu erhalten. Wir werden diese Themen mit Methoden des Erfahrungslernens erforschen und dabei neben dem kognitiven Verständnis auch die Weisheit des Körpers, der Emotionen und der Intuition einbeziehen, mit dem Ziel, uns gegenseitig zu stärken und zu inspirieren.
Hinweis: Diese Session ist mit der Nebenveranstaltung „Interessengruppen für den Klimaschutz gewinnen“ am Donnerstag, dem 26. September, verbunden.
Themen: Klima, Lebensqualität
Sprache: Englisch
Session-Leitung und eingeladene Fachleute: Serena Arduino (CIPRA International, Moderatorin) und Claudio Celada (LIPU-BirdLife Italy, Moderator), Guido Plassmann (ALPARC), Francesca Roseo (LIPU), Federico Beffa und Paolo Siccardi (Cariplo Stiftung)
Kurzbeschreibung:
Entdecken Sie, wie man in den Alpen von der Wissenschaft zum Handeln kommt – mit Hilfe von drei sofort einsetzbaren Instrumenten und Ansätzen. Die ALPARC-Kartographie zeigt Ihnen, wie das globale Ziel eines verstärkten Schutzes der Biodiversität durch mutige Entscheidungen und Raumplanung unter Berücksichtigung der wichtigsten Hindernisse und Landnutzungskonflikte erreicht werden kann. Die BirdLife-Karte zu Klimarefugien für den Schutz von Hochgebirgsarten zeigt Ihnen außerdem vorrangige Schutzgebiete sowie aktuelle und zukünftige Konflikte mit Skigebieten. Und zu guter Letzt erfahren Sie mehr über die Bemühungen der Cariplo-Stiftung bei der Entwicklung und Umsetzung regionaler Klimastrategien, die mehrere Interessengruppen einbeziehen und so den politischen Wandel beschleunigen. Nach dieser Veranstaltung kann niemand mehr behaupten, er wisse nicht, worauf sich Schutz und Entwicklung konzentrieren müssen und wie sie in die Politik integriert werden können!
Themen: Klima, Biodiversität
Sprache: Übersetzt in Deutsch, Französisch, Italienisch und Slowenisch
Weitere Informationen:
https://alparc.org/de/parks2030
https://www.alpine-space.eu/project/alpbionet2030/
https://www.alpine-space.eu/project/plantoconnect/
https://dataverse.unimi.it/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.13130/RD_UNIMI/ESCYNG
Ort: Obrtni dom, Ulica Gradnikove brigade 6 (Raum: Velika dvorana)
Session-Leitung und eingeladene Fachleute: Eva-Maria Cattoen (Lechtalps) und Wolfgang Pfefferkorn (CIPRA International)
Kurzbeschreibung:
Während die Debatten immer hitziger werden und radikale Meinungen zunehmen, war noch nie so klar, dass aktuelle gesellschaftliche und globale Herausforderungen wie die Klimakrise nur durch eine intensive und fruchtbare Zusammenarbeit gelöst werden können. In dieser Session sollen verschiedene Spannungsfelder und Chancen genauer beleuchtet werden. Mögliche Themen sind Klimaaktivismus, Einwanderung, Stadt-Land-Gegensätze an den Beispielen Wolf und Wasserknappheit.
Themen: Klima, Biodiversität, Lebensqualität
Sprache: Englisch
15:30 – 16:00
Pause
16:00 – 17:30
Session-Leitung und eingeladene Expert:innen: Wolfgang Pfefferkorn (CIPRA International), Jože Papež (Hidrotehnik d.o.o.)
Kurzbeschreibung:
Vielfältige Klimarisiken wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen stellen für lokale und regionale Behörden in den Alpen eine große Herausforderung dar. Wie können diese Risiken verhindert und die Interaktion zwischen den verschiedenen Beteiligten, d.h. die Risiko-Governance im Alpenraum auf lokaler und regionaler Ebene, verbessert werden?
Thema: Klima
Sprache: Übersetzt in Deutsch, Französisch, Italienisch und Slowenisch
Weitere Informationen:
https://www.alpine-space.eu/project/adaptnow/
https://www.alpine-space.eu/project/x-risk-cc/
https://www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/multibios?set_language=de
Session-Leitung und eingeladene Fachleute: Marion Ebster-Kreuzer (CIPRA International)
Kurzbeschreibung:
Böden sind eine wertvolle Ressource – und werden oft übersehen. Ein umsichtiger Umgang mit dem Boden erfordert Kenntnisse und eine gewisse Beziehung zu ihm – denn wir schützen nur, was wir kennen und wozu wir eine Beziehung haben. Daher wird diese Session zunächst eine Einführung in Beispiele für einen umsichtigen Umgang mit Böden und intelligente Entsiegelungsmaßnahmen in den Alpen geben. Danach folgt eine kleine interaktive Sitzung im Freien, bei der die Teilnehmenden eingeladen sind, buchstäblich mit dem Boden in Berührung zu kommen und ihre Ideen, Eindrücke und Kenntnisse über den Boden auszutauschen.
Diese Session wird im Rahmen des Ground:breaking Projekts durchgeführt.
Thema: Biodiversität
Sprache: Englisch
Weitere Informationen:
https://www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/ground-breaking?set_language=de
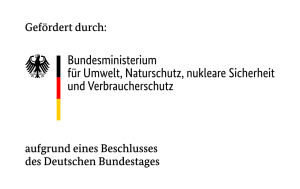
Ort: Obrtni dom, Ulica Gradnikove brigade 6 (Raum: Velika dvorana)
Session-Leitung und eingeladene Fachleute: Aleš Kegl (Interreg-Alpenraumprogramm), Blaž Likozar (Alps4greenC Projekt), Katarina Šrimpf Vendramin und Cassiano Luminati (AlpTextyles), Eva Lienbacher und Christine Vallaster (CEFoodCycle)
Kurzbeschreibung:
Die Kreislaufwirtschaft gilt als ein geschlossenes System, in dem bestehende Materialien so lange wie möglich genutzt werden. Produkte und Materialien werden durch Prozesse wie Instandhaltung, Wiederverwendung, Wiederaufbereitung, Recycling und Kompostierung im Kreislauf gehalten. Dieser Ansatz ist für den Alpenraum von zentraler Bedeutung, vor allem wenn wir die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern und das Ziel der EU erreichen wollen, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Gewinnen Sie einen Einblick in die Art und Weise, wie diese Herausforderung durch Interreg-Alpenraumprogramm-Projekte in Angriff genommen wird, insbesondere in den Bereichen Textilien (Alptextyles), grüner Kohlenstoff (Alps4greenC), Lebensmittel und Getränke (CEFoodCycle). Zu erfahren, wie ihre einzigartigen Projekte und Lösungen unser Leben kreislauffähiger machen, kann ein hervorragender Anfang für Ihren eigenen Übergang zum Kreislaufdenken sein.
Thema: Lebensqualität
Sprache: Englisch
19:00
Abendprogramm
Ort: Rathaus von Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Abendessen mit Kulturprogramm
Gastgeber sind die Stadt Nova Gorica und GO! 2025.
Ausstellung des Triglav Nationalparks
Vor dem Rathaus von Nova Gorica
Vom 17. September bis zum 13. Oktober 2024 wird die Fotoausstellung „ Ewiger Wandel, eingefangen in einem fotografischen Objektiv“ unter den Arkaden des Gemeindehauses der Stadtgemeinde Nova Gorica zu sehen sein. Sie wird während der AlpenWoche vom Nationalpark Triglav anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Gründung des Alpenschutzparks präsentiert.
Die Ausstellung besteht aus Schwarz-Weiß-Fotografien des Dichters der Bergfotografie, Jaka Čop, und zeitgenössischen Farbfotografien derselben Motive. Die Ausstellung ist eine fotografische Zeitreise, die dem Betrachter anhand verschiedener bekannter und weniger bekannter Motive aus dem Triglav-Nationalpark die Veränderungen im Parkgebiet zeigt. Gleichzeitig ist sie eine fotografische Darstellung des Nationalparks in zwei verschiedenen Techniken und Zeiträumen.
Herzlich willkommen!
Mittwoch, 25. September
08:30 – 17:00
Exkursion
Soča-Tal – Aus der Vergangenheit lernen, im Heute leben
Organisiert von: Posoški razvojni center – Entwicklungszentrum des Soča-Tals
Kurzbeschreibung:
Diese ganztägige Exkursion führt uns in die Kleinstadt Kobarid (Oberes Soča-Tal). In der Stadt und ihrer Umgebung werden wir uns auf wesentliche Elemente des historischen Erbes konzentrieren und erfahren, wie dieses Erbe heute weiterlebt, vor welchen Herausforderungen es steht und wie es sich auf die Lebensqualität der Bevölkerung auswirkt. Wir besuchen das Museum des Ersten Weltkriegs, diskutieren im Molkereimuseum über das Gemeingut und machen einen Spaziergang auf dem historischen Lehrpfad von Kobarid / Karfreit, der bedeutende historische Orte und Naturschönheiten miteinander verbindet (2-3 Stunden). Unterwegs erfahren Sie auch etwas über die berühmte Marmorierte Forelle, eine endemische Art des Einzugsgebiets der nördlichen Adria.
Praktische Informationen
Sprache: Englisch
Teilnehmendenzahl: max. 30
Mittagessen ist inkludiert
Ausrüstung: Wanderschuhe, Regenbekleidung
Kosten: 20 Euro
Thema: Lebensqualität
09:00 – 10:30
Ort: Obrtni dom, Ulica Gradnikove brigade 6 (Raum: Velika dvorana)
Session-Leitung und eingeladene Fachleute: Katharina Gasteiger (Allianz in den Alpen), Ann-Kristin Winkler (WWF), Georg Kaser (Glaziologe)
Kurzbeschreibung: Die Session befasst sich mit dem Rückgang der Schneedecke in den Alpen aufgrund des Klimawandels und dessen Auswirkungen auf lokaler Ebene. Der renommierte Glaziologe Georg Kaser führt in das Phänomen der Gletscherschmelze und ihre Auswirkungen ein. Darüber hinaus loten die Session-Teilnehmenden die Herausforderungen für die lokalen Gemeinschaften aus: Soll die Infrastruktur zur Verbesserung der künstlichen Beschneiung ausgebaut werden? Ist die Entwicklung in höheren Lagen der richtige Weg? Oder schaffen wir den Übergang weg von der Schneeabhängigkeit?
In einem Rollenspiel werden verschiedene Standpunkte zu diesem komplexen und schwierigen Thema erkundet und die sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen beleuchtet.
Ziel dieser Veranstaltung ist es nicht, fertige Lösungen zu präsentieren – denn, wenn es Lösungen gibt, sind sie extrem individuell angelegt – sondern einen offenen Diskurs anzuregen. Die Session wird von den Projektergebnissen des EU-Projekts BeyondSnow und der Arbeit des WWF zu alpinen Freiräumen und Gletscherschutz profitieren.
Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „BeyondSnow on Tour“.
Themen: Klima, Biodiversität, Lebensqualität
Sprache: Englisch
Weitere Informationen:
Session-Leitung und eingeladene Fachleute: Julika Jarosch (Projektmanagerin, CIPRA Frankreich), Nika Mohorič von den slowenischen Forstdiensten / Zavod za gozdove Slovenije Ljubljana, Projektpartner im LIFE Safe Grazing Projekt, Kaspar Schuler, Geschäftsführer der CIPRA International und Eva-Maria Cattoen, LechtAlps
Kurzbeschreibung: Die Session befasst sich mit den modernen Herausforderungen der Weidewirtschaft und insbesondere mit der Aufrechterhaltung der Weide-Aktivitäten in Berggebieten, die auch ein klassischer Hotspot für die Biodiversität sind und angesichts des Klimawandels immer mehr zu einem Refugium für diverse Arten werden. In dieser Veranstaltung werden insbesondere die Konflikte untersucht, die durch das Zusammenleben von Menschen und Wildtieren im Alpenraum entstehen, und Perspektiven für politische Entscheidungsträger/-innen und Beteiligte der Weidewirtschaft diskutiert.
Themen: Klima, Biodiversität, Lebensqualität
Sprache: Englisch
Weitere Information:
Session-Leitung und eingeladene Fachleute: Matej Ogrin (CIPRA Slowenien), Aleš Zdešar (Nationalpark Triglav), Alexandra Dörfler (Bundesministerium für Klimaschutz, Österreich), Teilnehmende des Yoalin-Projekts und Mitglieder des CIPRA Jugendbeirates
Kurzbeschreibung: Lebensqualität und Aufenthaltsqualität sind nicht zu trennen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung zu gewährleisten. Diese spiegelt sich in der Zufriedenheit mit der umgebenden Umwelt und einer positiven räumlichen Identität wider. Ein touristisches Angebot, das aus dem Engagement für den Erhalt der Lebensqualität der lokalen Bevölkerung resultiert, bildet die Grundlage für die soziale Komponente des nachhaltigen Tourismus. In diesem Workshop werden die Wahrnehmung der Lebensqualität durch verschiedene Zielgruppen (z.B. lokale Bevölkerung, Touristinnen und Touristen, im Tourismus Beschäftigte, Jugendliche) diskutiert und Aspekte der Tragfähigkeit des Gebietes, des Naturschutzes und der Erreichung von Klimazielen in Verbindung mit der Erhaltung der Lebensqualität in den Alpen angesprochen.
Thema: Lebensqualität
Sprache: Übersetzt in Deutsch, Französisch, Italienisch und Slowenisch
Weitere Informationen:
10:30 – 11:00
Pause
11:00 – 12:00
Abschlussplenum
In einem Fishbowl Setting reflektieren wir gemeinsam mit Blanka Bartol (Slowenisches Ministerium für Natürliche Ressourcen und Raumplanung), Georg Kaser (Glaziologe), Claudio Celada (LIPU) und einer jungen Person aus dem CIPRA Jugendbeirat die Erkenntnisse und Impulse der letzten beiden Tage und geben ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
12:00 – 14:00
Mittagessen
13:00 – 14:00
Interne Veranstaltung
Organisiert von: Katharina Gasteiger (Allianz in den Alpen)
Kurzbeschreibung: Jährliche Mitgliederversammlung des Gemeindenetzwerks „Allianz in den Alpen“, für Vereinsmitglieder
14:30 – 16:30
Interne Veranstaltung
Organisiert von: Magdalena Holzer (Verein Alpenstadt des Jahres)
Kurzbeschreibung: Mitgliederversammlung des Vereins Alpenstadt des Jahres, für Vereinsmitglieder
15:00 – 18:45
Side event
Alpine Kultur: Spiegel der Herausforderungen und Chancen
Aula Magna der Universität Trieste – Polo goriziano, Via Alviano 18 – 34170 GORIZIA
Shuttle: Abfahrt um 14.30 Uhr vom Hotel Perla, Kidriceva ulica 7
Organisiert von: Italienische Delegation der Alpenkonvention/Italienisches Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit (MASE), Gemeinde Gorizia, Region FVG, GECT-GO Stadtverwaltung Gorizia und Universität Triest /Verein „The Visionaries“
Redner/-innen: Begrüßung durch Stadträtin Patrizia Artico; Eröffnungsrede Guido Pettarin (Verein Filologica Friulana); Annibale Salsa (Universität Genova), PierPaolo Viazzo (Universität Turin); Federica Corrado (Politecnico Turin), Roberto Louvin (Universität Triest) und weitere
Moderator: Paolo Angelini (MASE)
Dolmetschung und Gestaltung: EURAC Research (Bozen/Bolzano), IntrAlp Associazione Professionale & Converso (ABB S.r.l. of Milan).
Kurzbeschreibung: Förderung einer Diskussion über die alpine Kultur auf der ständigen Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Erhaltung und Innovation, zwischen der Bewahrung der historischen Wurzeln und der Notwendigkeit der Anpassung an die Veränderungen der modernen Welt. Eine Gegenüberstellung der Erzählungen und Gefühle derjenigen, die in den Bergen unter widrigen Umständen und manchmal in Isolation leben. Auf der Suche nach einem gemeinsamen und ausgewogenen Ansatz, der die einzigartigen Merkmale dieses Gebietes, den geringen Flächenverbrauch und die immer umfangreicheren technologischen Möglichkeiten zur Unterstützung weniger invasiver Arbeiten berücksichtigt. Welche Verpflichtungen gibt es, um eine angemessene und nachhaltige sozioökonomische Entwicklung in den Bergen zu fördern?
Praktische Informationen
Sprache: Deutsch, Italienisch, Französisch und Slowenisch
Teilnehmendenzahl: maximal 100
Abendessen im Anschluss
Kostenlose Teilnahme (nur Anmeldung notwendig)
19:00 – 21:30
Abendveranstaltung
Sala del Pastor Angelicus Via dei Rabatta 20 – 34170 GORIZIA
Organisiert von: Italienische Delegation der Alpenkonvention/Italienisches Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit, Gemeinde Gorizia, Verein „The Visionaries“, Staatliches Institut für Lebensmittel- und Weinkultur „S. Pertini“ Monfalcone
Kurzbeschreibung: Thematisches Abendessen für Teilnehmende der AlpenWoche mit kulturellen Beiträgen der Co-Organisator:innen
Praktische Informationen
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Slowenisch
Nach dem Abendessen bringt ein Shuttle-Transfer die Teilnehmenden zurück ins Perla Hotel in Nova Gorica. Abfahrt um 21.30 Uhr von der Pastor Angelicus Hall (Via dei Rabatta 20, 34170 Gorizia, IT).
Donnerstag, 26. September
08:30 – 13:00
Interne Veranstaltung
CIPRA International: Delegiertenversammlung
Organisiert von: Nora Leszczynski (CIPRA International)
Kurzbeschreibung: Delegiertenversammlung von CIPRA International
09:00 – 16:00
Side event
Interessengruppen für den Klimaschutz gewinnen
Organisiert von: Alpiner Klimabeirat
Beim Klimaschutz geht es vor allem darum, die Menschen dazu zu bringen, Entscheidungen zu treffen, zu handeln, zu akzeptieren und ihr Leben und ihre Arbeitsweise zu ändern. Bei der Umsetzung des Klimaaktionsplans 2.0 müssen auch Interessengruppen „jenseits der Blase“ erreicht und ins Boot geholt werden. Dies erfordert die Fähigkeit, Menschen in vielen verschiedenen Situationen zu motivieren und zu begleiten. Erste Erkenntnisse darüber, wie man Menschen im Rahmen von Klimaschutzmaßnahmen besser erreichen kann, werden während eines vom Alpinen Klimabeirat (ACB) der Alpenkonvention angebotenen Trainings erkundet.
Die folgenden Themen werden behandelt:
Verständnis der Phasen des Wandels und Modelle sozialer Diffusion: Analyse der Situation der Interessengruppen und ihrer Bedürfnisse in den verschiedenen Phasen des Wandels
Schärfung der eigenen „Rolle“ bei der Begleitung von Veränderungsprozessen: Anpassung des eigenen Ansatzes an die Situation der Interessengruppen und die verschiedenen Phasen des Wandels
Umgang mit unterschiedlichen Reaktionen: Verständnis und Umgang mit den Auswirkungen von Maßnahmen für Veränderung und Engagement auf die Interessengruppen, einschließlich Widerstand
Anwendung spezifischer Instrumente zur Unterstützung von Veränderungsprozessen: Einsatz positiver Erzählungen und anderer Methoden zur Unterstützung von Engagement und Veränderung
Überbrückung der Kluft zwischen Wissen und Handeln: Gestaltung von Maßnahmen und Projekten unter Berücksichtigung der psycho-soziologischen Faktoren
Das Training findet auf Englisch statt

Die AlpenWoche beabsichtigt, ein Green Event der Alpenkonvention zu sein und nach hohen Nachhaltigkeitsstandards organisiert zu werden.
Ort: Rathaus von Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Abendessen mit Kulturprogramm
Gastgeber sind die Stadt Nova Gorica und GO! 2025.